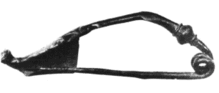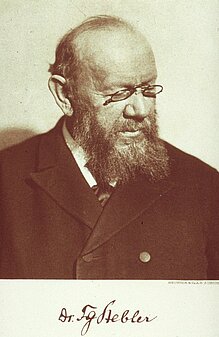10'000 v.Chr
Ende der letzten Eiszeit: Rückzug der Gletscher, grosse Bergstürze aus haltlosen Felswänden: Marufälli, Gstein, „Zen grossen Steinen" [2,5]
1900 - 1600 v. Chr.
früh-bronzezeitliche Bewohner beim Weiler Sisetsch hinterlassen Schalensteine (Bedeutung ist unklar: Kultstätten, Gewinnung von Gesteinsstaub?) [2]
1250 v.Chr. u. früher
Mittel-bronzezeitliche Höhensiedlung auf dem Kasteltschuggen [2,3,4] (einziger Fundort im Wallis aus dieser Periode!); Bewohner dürften von der Viehzucht gelebt haben (Knochenfunde aus dem Siedlungsgebiet zeigen mehrheitlich Haustiere, kaum Wild); Trockenmauern sind heute noch gut erkennbar; diverse Funde aus mehreren Ausgrabungen wie Keramik und Bronzeobjekte (Dolch-/Meisselklingen) werden heute im Schweizerischen Landesmuseum (ZH) aufbewahrt. Die gefundenen Mauerreste und die topographische Situation machen eine Deutung als "befestigte Siedlung" wahrscheinlich [4].
750 - 500 v. Chr.
Feuchtes u. kaltes Klima in den Alpen drängt die menschlichen Siedlungsräume im Oberwallis zurück (Fehlen von Funden aus dieser Periode oberhalb von Visp) [5]
450 v. Chr - 100 n. Chr.
Jung-eisenzeitliche (Früh-Latene) keltische Siedlung (Uberer) beim Weiler Sisetsch; in den Äckern zwischen Sisetsch und Widum Entdeckung von 6-10 Gräbern mit zahlreichen Fundstücken aus Bronze (Armspangen, Fibeln und verzierte Armbänder) und Topfsteinbruchstücke (meist aus Giltstein) aus einer Topfsteinverarbeitungstelle (heutiger Aufbewahrungsort: kantonales Museum für Archäologie in Sion und t.w. historisches Museum in Bern). Das Material für die Topfsteine dürfte aus dem nahen Steinbruch „zur Grube" stammen.
15 v.Chr. - 400 n. Chr.
Das Wallis steht unter römischer Herrschaft
800 - 1000 n. Chr.
Germanische Alemannen besiedeln von Norden vermutlich über die Grimsel (evt. auch über Lötschenpass und Gemmi) das Oberwallis und verdrängen bzw. vermischen sich allmählich mit der keltischen Urbevölkerung. Über längere Zeit dürften die christlichen Alemannen neben den keltischen Urbewohnern (Heiden) gelebt haben, was aus der Existenz von „Heidenhäusern mit Seelenglotz" und Flurnamen wie „Heidenegg" gefolgert werden kann.
1150
das 1. erhaltene schriftliche Dokument über Zeneggen betreffend Wasserankauf aus dem Jungbach. Die Sicherstellung des Wässerwassers ist auch in den folgenden Jahrhunderten für Zeneggen ein zentrales Problem, wie diverse Urkunden über Nutzung und Wartung der Augsbordwasserleitung und später über Wasserzukauf aus dem Ginalstal belegen.
1388
Zenegger unterstützen die Visper im Verteidigungskampf gegen die Savoyer („Mannenmittwoch")
1394
In einem Alpreglement wird bereits die Nutzung der Niederstenalpe im Nanztal durch Zenegger erwähnt (besteht bis zum heutigen Tage)
Bis 1400
Zeneggen steht politisch im Lehensverhältnis zu wohlhabenden Visper Familien
1556
Nikolaus Im Eich aus Zeneggen, dessen Familie den Weiler Eich bewohnt, wird Landeshauptmann des Wallis.
1586
Festsetzung der Dorfstatuten bei der Bauernzunft
Nach dem 16. Jh.
Jahreszeitliche Wanderung der Bevölkerung aufgrund mehrstufiger Mischwirtschaft (Viehhaltung, Acker- und Rebbau)
ca. 1600
Kalkverarbeitung und Schmiedehandwerk werden von Zeneggern ausgeübt. Einen gut-erhaltenen historischen Kalkofen kann man heute noch im Eggwald besichtigen.

1608 (?)
Bau des ersten Gotteshauses (alte Kapelle neben Burgerhaus, Abbruch in diesem Jahrhundert beim Strassenbau)
1611
Bau des Burgerhauses
1666
Bau der Dreifaltigkeitskapelle (am Standort der heutigen Pfarrkirche)
1697
Territorialfestsetzung mit der Gemeinde Stalden
1716
Zeneggen wird Rektorat (Kirche ohne Status Pfarrkirche) mit eigenem Geistlichen (siehe auch Priester der Pfarrei Zeneggen)
1718
Bau des Pfarrhauses (erweitert 1792)
1751
Vergrösserung Dreifaltigkeitskapelle und Ergänzung um Glockenturm (in den beiden Folgejahren werden die beiden ersten Glocken gegossen; spätere Ergänzungen - 1763 und 1846 - um weitere Glocken ermöglichten das Zenegger Glockenspiel)
1754
Zeneggen erhält Status einer Pfarrei (erst 1795 - 1819 kann man sich von diversen Abgaben an die Mutterkirche in Visp und bischöfliche Tafel befreien)
1799
6 Zenegger fallen im Pfyn-Wald im Kampf gegen französische Soldaten
1807
In der Nacht vom 21. zum 22. Juli 1807 brannte der Weiler Alt-Zeneggen (ehemals Weiler "Zeneggen") nahezu vollständig (bis auf 1 Haus) ab.
1819
Bau der Kapelle auf dem Biel zu Ehren der 14 Nothelfer

1820
Der letzte Bär wird auf Zenegger Gebiet gejagt (Tatze im Burgerhaus).
Bis 1821
Zeneggen muss Brückenzollabgaben und Unterhaltungskosten an Visp entrichten
1845
Territorialfestsetzung mit der Gemeinde Visperterminen
1855
Versiegen mehrerer Quellen nach einem heftigen Erdbeben
1871
Territorialfestsetzung mit der Gemeinde TörbeI
1877 bis 1881
Bau der Pfarrkirche am Standort der Dreifaltigkeitskapelle, der Glockenturm wurde übernommen; Renovationen in den Jahren 1932/33 (u.a. Glasfenster), 1955 und siebziger / achtziger Jahren
1865 bis 1900
20 Zenegger schliessen sich Auswanderungswelle nach Amerika an (u.a. wegen wiederholter Trockenheit)
1913
In den Äckern zwischen Sisetsch und Widum an der Heideneck von Theodor Gattlen beim Pflügen 6 - 10 wurden keltische Gräber entdeckt, welche diverse Fundstücke aus der La-Tene-Zeit ( jüngere Eisenzeit, 450 v. Chr. - 1 Jh. n.Chr.) enthielten.
1918 - 1920
Dr. F. G. Stebler (*1852-+1935; Privatdozent ETHZ 1876-1900 für techn.landwirtschaftl. Fächer) verfasst seine "Monographie aus den Schweizer Alpen" (1), welche detailliert Zeneggen und die Kultur seiner Bewohner beschreibt.
1920
erste Telefonverbindung
1927
Anschluss ans Stromnetz.
1928
Eröffnung der Dorfwirtschaft
1931 - 1934
Bau der Strasse nach Zeneggen
1947 - 1951
Bau der neuen Augstbordwasserleitung [6] / Trinkwasserversorgung
1955
Im Sommer 1955 entdeckt eine Basler Schulklasse auf dem Kasteltschuggen beim Graben im Innern des «Turmes» eine Anzahl Scherben von bronzezeitlichen Gefässen [3]. Johannes Senti (Muri BE) führte systematische Ausgrabungen an der Fundstelle durch.
1960-1963
Dr. Rudolf Degen führt weitere Ausgrabungen auf dem Kasteltschuggen durch und berichtet später in "Wallis vor der Geschichte" [3].
1994
Fertigstellung von Mehrzweckhalle und neuem Schulhaus
Ab 1998
Restaurierung der historischen Bewässerungsysteme (Suonen) im Rahmen des Projektes "Kulturlandschaft Zeneggen 2000". Unter anderem wurde der Bielweiher instand gesetzt.
2004
Einweihung der neuen Steiner-Orgel am 20. Mai 04 (Christi Himmelfahrt)
2008 / 2009
Diverse Erschliessungsstrassen werden im Bereich Egga und Alt-Zeneggen gebaut. Unterhalb Kastelschuggen wird ein Erddamm zum Steinschlagschutz für die unterhalb gelegenen Wohnhäuser errichtet.
Literaturhinweise
- Stebler F.G., „Die Vispertaler Sonnenberge", Jahrbuch der Schweiz, 56. Jahrgang, Alpenclub, Bern, 1921, siehe auch Fotogalerie mit historischen Fotos von Stebler
- H.H. Huber, T. Keller, E. Undritz, T. Kenzelmann, Urs Gerber, "Kleine Wunderwelt Zeneggen" , 2. Auflage, 1978, Dreispitz-Verlag Urs Gerber / Wichtrach
- „Das Wallis vor der Geschichte", Sitten Kantonsmuseum, Sept. 1986, S. 298-301 (Dr. R. Degen: Zeneggen Kasteltschuggen), 324, 330/1, 354
- David-Elbiali M., „Les influences culturelles en Valais au debut du Bronze final au travers de decouvertes de Zeneggen-Kasteltschuggen", Jahrbuch der Schweiz. Ges. f. Ur- und Frühgeschichte, Bd. 77, 1994, S. 35-52 (pdf-File 1.6 MB zun Download)
- Walliser Geschichte Bd. 1, Herausgeber kantonales Erziehungsdepartement Sitten, 1983
- Kenzelmann Klaus, Die Geschichte des Augstbordwassers ( Emd, Törbel, Zeneggen), Rotten-Verlag, Visp, 2001, ISBN 3-907624-22-X
- Jossen, Erwin; "Zeneggen - Sonnenterrasse im Vispertal" (illustrierte Dorfmonografie, Rotten-Verlag, Visp, 2006); ISBN-10: 3-90576-12-9; ISBN-13: 978-3-905756-12-8